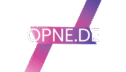Jobsharing beschreibt ein Arbeitsmodell, bei dem sich zwei oder mehr Personen eine Vollzeitstelle teilen und die Aufgaben im gegenseitigen Einvernehmen aufteilen. Anders als bei einfachen Teilzeitlösungen definieren sich die Tandempartner gemeinsam als Einheit und tragen dieselbe Verantwortungs- und Entscheidungsbefugnis. In Deutschland ist Jobsharing rechtlich zulässig, solange die Rechte und Pflichten klar geregelt sind und die Gesamtarbeitszeit den Umfang einer Vollzeitstelle abbildet. Das Modell fördert flexible Arbeitszeiten, erleichtert eine bessere Work‑Life‑Balance und ermöglicht denjenigen, die familiäre oder persönliche Verpflichtungen haben, weiterhin anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen.
Beim Jobsharing arbeiten die Tandempartner oft eng zusammen: Sie stimmen sich über Aufgaben ab, strukturieren Zuständigkeiten und vertreten sich bei Bedarf gegenseitig. Die Gestaltung der Arbeitszeit ist flexibel – von täglichen Übergaben bis hin zu wöchentlichen Blocks. Wichtig ist, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer von Anfang an einen offenen Dialog über Erwartungen führen und die gemeinsame Verantwortung vertraglich festlegen. Gleichzeitig unterscheidet sich Jobsharing deutlich von klassischen Teilzeitmodellen, weil die Leistung der Stelle als Ganzes im Fokus steht und nur durch Zusammenarbeit erfüllt werden kann.
Auch im Kontext der Digitalisierung und des New‑Work‑Gedankens gewinnt Jobsharing an Bedeutung. Cloud‑basierte Tools, digitale Kommunikation und agile Arbeitsmethoden erleichtern es, Wissen zu teilen und Aufgaben zu koordinieren. Generationenübergreifende Teams können sich gegenseitig in ihrer Expertise ergänzen, während Unternehmen auf diese Weise flexibler auf Marktveränderungen reagieren. Dadurch wird Jobsharing zu einem zukunftsfähigen Arbeitsmodell, das sowohl Personalpolitik als auch Unternehmenskultur nachhaltig prägt.
Formen des Jobsharing
Jobsharing ist nicht gleich Jobsharing. In der Praxis haben sich verschiedene Varianten etabliert, die sich hinsichtlich Verantwortungsumfang, Hierarchie und organisatorischer Abstimmung unterscheiden. Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die gängigen Modelle:
| Modell | Beschreibung | Verantwortung | Einsatzbeispiele |
| Job Splitting | Eine Vollzeitstelle wird in zwei unabhängige Teilzeitstellen aufgeteilt. Jede Person hat separate Aufgaben und arbeitet autark; Abstimmung untereinander findet kaum statt. | Individuelle Verantwortung für klar abgegrenzte Aufgaben; keine gemeinsame Verantwortung. | Verwaltung, Sachbearbeitung, repetitive Tätigkeiten |
| Job Pairing | Zwei Personen teilen sich eine Stelle. Sie agieren als Team, stimmen Arbeitszeiten ab und treffen Entscheidungen gemeinsam. | Gemeinsame Verantwortung und einheitliche Vertretung nach außen; beide sind Ansprechpartner. | Kreativabteilungen, Projektmanagement, Consulting |
| Top Sharing | Führungskräfte teilen sich eine Führungsposition. Sie sind gemeinsam für Leitung, Budget und Personal verantwortlich und ergänzen ihre Kompetenzen. | Gemeinsame Führungsverantwortung, paritätische Entscheidungsbefugnis. | Abteilungsleitung, Geschäftsführung, strategische Projekte |
| Peer‑Tandem | Ähnliche Positionen werden von zwei Personen mit identischem Stellenprofil in Abstimmung ausgeführt. Regelmäßige Koordination, aber jeweils eigenständige Aufgabenpakete. | Aufgabenspezifische Verantwortung, aber laufende Abstimmung über Schnittstellen. | Sales‑Tandems, wissenschaftliche Mitarbeit, HR‑Projekte |
Diese vier Modelle spiegeln unterschiedliche Anforderungen wider: Während Job Splitting besonders bei standardisierten Aufgaben sinnvoll ist, setzt Job Pairing auf gegenseitige Vertretung und kontinuierliche Abstimmung. Top Sharing steht für geteilte Führungsverantwortung und eignet sich vor allem für erfahrene Manager:innen, die ihre Expertise bündeln möchten. Peer‑Tandems wiederum erleichtern die Zusammenarbeit auf gleicher Ebene und ermöglichen es, fachliche Schwerpunkte zu setzen. Unternehmen können das passende Modell je nach Branche, Teamgröße und Arbeitsinhalten auswählen.

Vorteile für Arbeitnehmende und Unternehmen
Das Jobsharing‑Modell bietet zahlreiche Vorteile. Die wichtigsten lassen sich sowohl für Mitarbeitende als auch für Unternehmen benennen:
- Flexibilität: Jobsharing ermöglicht eine flexible Einteilung der Arbeitszeit. Insbesondere Eltern, Pflegende oder Menschen in Weiterbildung können Karriere und Privatleben besser miteinander vereinbaren.
- Wissensaustausch und Innovation: Zwei Personen bringen unterschiedliche Erfahrungen und Blickwinkel ein. Durch regelmäßige Abstimmung entstehen kreative Lösungen und eine höhere Qualität der Arbeit.
- Produktivität und Kontinuität: Zwei Köpfe arbeiten effizienter und können sich gegenseitig vertreten. Das reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Erreichbarkeit für Kolleg:innen und Kund:innen.
- Attraktivität als Arbeitgeber: Unternehmen, die flexible Modelle anbieten, steigern ihre Attraktivität, erhöhen die Diversität im Führungsteam und binden Talente langfristig.
- Weniger Burnout‑Gefahr: Durch geteilte Verantwortung sinken Arbeitsbelastung und Stress, was die Gesundheit der Mitarbeitenden fördert.
- Karrierechancen trotz Teilzeit: Durch Jobsharing können Fach‑ und Führungskräfte auch in Teilzeit anspruchsvolle Positionen wahrnehmen und ihre Karriere vorantreiben.
- Kompetenzentwicklung: Tandempartner lernen voneinander, erweitern ihren fachlichen Horizont und profitieren vom direkten Austausch – das erhöht die Lernkurve und fördert persönliches Wachstum.
- Wettbewerbsvorteil im War for Talents: Unternehmen, die moderne Arbeitsmodelle anbieten, heben sich von der Konkurrenz ab. Jobsharing signalisiert Offenheit für alternative Karrierewege und spricht qualifizierte Bewerber:innen an.
Herausforderungen und Risiken
So attraktiv Jobsharing auch ist – das Modell bringt Herausforderungen mit sich. Die folgenden Punkte sollten bei der Planung berücksichtigt werden:
- Koordination: Eine klare Abstimmung der Aufgaben und eine transparente Kommunikation sind notwendig, um Doppelarbeit oder Lücken zu vermeiden.
- Konfliktpotenzial: Unterschiedliche Arbeitsstile, Ambitionen oder Erwartungen können zu Spannungen führen. Regelmäßige Feedbackgespräche helfen, Konflikte frühzeitig zu klären.
- Arbeitsrecht und Vergütung: Arbeitszeitmodelle, Urlaubsansprüche und Gehaltsstrukturen müssen rechtlich korrekt geregelt werden, damit es nicht zu Ungleichheiten kommt.
- Kosten und Organisationsaufwand: Für den Arbeitgeber entstehen anfänglich höhere Koordinationskosten. Allerdings amortisieren diese sich durch höhere Produktivität und geringere Fluktuation.
- Akzeptanz im Team: Kolleg:innen und Vorgesetzte müssen sich an zwei Ansprechpersonen gewöhnen. Eine klare Darstellung der Zuständigkeiten fördert die Akzeptanz.
- Administrativer Aufwand: Zeiterfassung, Vertretungsregelungen und Leistungskontrolle sind komplexer als bei Einzelbesetzung und erfordern durchdachte Prozesse.
Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren
Damit Jobsharing reibungslos funktioniert, sind bestimmte Rahmenbedingungen erforderlich. Folgende Voraussetzungen gelten als zentral:
- Offene Kommunikation: Tandempartner müssen sich regelmäßig austauschen und gemeinsame Tools zur Dokumentation nutzen, um stets auf dem gleichen Stand zu bleiben.
- Komplementäre Kompetenzen: Idealerweise ergänzen sich die Tandempartner in ihren Fähigkeiten. Das steigert die Qualität der Arbeit und schafft Mehrwert.
- Vertrauen und Respekt: Eine partnerschaftliche Haltung, klare Rollenabsprachen und gegenseitiges Vertrauen sind unerlässlich.
- Unterstützung durch das Unternehmen: Flexible Arbeitszeitregelungen, anpassbare IT‑Systeme und eine offene Unternehmenskultur schaffen die Grundlage für erfolgreiches Jobsharing.
- Schriftliche Vereinbarungen: Arbeitsvertragliche Regelungen zu Aufgabenverteilung, Vertretung und Entscheidungsbefugnissen helfen, spätere Missverständnisse zu vermeiden.
- Gleiche Werte und Ziele: Tandempartner sollten ähnliche Werte und Ziele verfolgen, um Konflikte zu reduzieren und ein gemeinsames Leitbild zu haben.
- Strukturiertes Onboarding: Ein sorgfältig geplantes Onboarding‑Programm unterstützt neue Tandems dabei, sich schnell einzuspielen und gemeinsame Arbeitsweisen zu entwickeln.
Praxisbeispiele und Zukunftsausblick
Ein Blick auf die Praxis zeigt, dass Jobsharing inzwischen auch in leitenden Positionen erfolgreich implementiert wird. Ein bekanntes Beispiel ist die Jobsharing‑Initiative von Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Hier teilen sich Managerinnen und Manager Führungspositionen, um anspruchsvolle Karrierewege mit Familienleben zu verbinden und die Mutterrolle nicht zur Karrierebremse werden zu lassen. Laut Berichten erzielen Unternehmen, die Jobsharing einsetzen, höhere Mitarbeitendenzufriedenheit, mehr Diversität in Führungspositionen und eine bessere Innovationsfähigkeit. Auch mittelständische Unternehmen und öffentlich‑rechtliche Institutionen experimentieren mit Jobsharing‑Modellen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und Wissenstransfer zu fördern.
Wer interessiert sich für Jobsharing? Laut Interviews und Studien reichen die Zielgruppen von jungen Eltern, die Karriere und Familie verbinden wollen, über ältere Fachkräfte, die ihre Erfahrung einbringen möchten, bis hin zu ambitionierten Generation‑Y‑Vertreter:innen, die Selbstverwirklichung suchen. Vor allem Unternehmen im technologieaffinen oder beratenden Umfeld profitieren von der Möglichkeit, zwei Köpfe für komplexe Aufgaben einzusetzen und gleichzeitig Nachwuchskräfte zu entwickeln.
Für die Zukunft erwarten Expert:innen eine stärkere Verbreitung des Jobsharing‑Modells in der New‑Work‑Landschaft. Die demografische Entwicklung, der Mangel an Fachkräften und der Wunsch vieler Generationen nach Flexibilität üben Druck auf traditionelle Arbeitsstrukturen aus. Jobsharing bietet Unternehmen eine attraktive Lösung, um personelle Ressourcen effizient zu nutzen und zugleich engagierten Menschen eine anspruchsvolle Karriere zu ermöglichen. Digitale Werkzeuge und kollaborative Arbeitsformen erleichtern die Abstimmung und machen das Modell auch in verteilten Teams realisierbar. Dennoch bleibt festzuhalten, dass nicht jede Stelle für Jobsharing geeignet ist – in sehr dynamischen Umfeldern oder bei stark personenbezogenen Tätigkeiten kann das Modell an seine Grenzen stoßen.